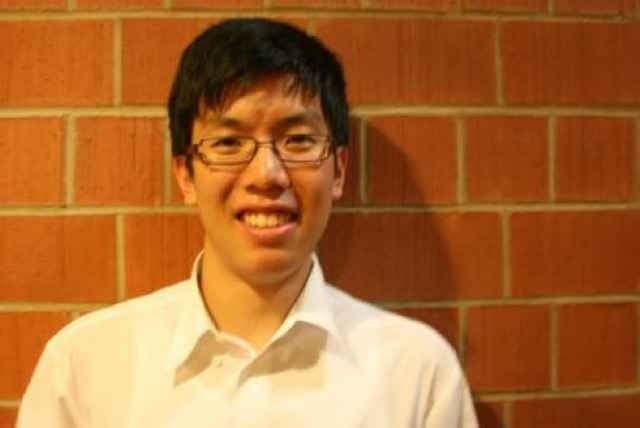Zum Tod von Alfred Brendel: Als ich dem Star-Pianisten einst die Hand schüttelte
Es war nur ein Augenblick. Aber ich kam dem Ausnahmekünstler ganz nah.
Herzlich willkommen in der BELETAGE. Mein Name ist Manuel C. Lorenz, und ich schreibe hier unregelmäßig über Kunst und Kultur, die mich bewegt. Zuletzt habe ich über besondere Berlin-Momente geschrieben. Diesmal gibt’s eine Art Nachruf …
Alfred Brendel war keiner meiner Helden. Kein Radu Lupu (†2022), kein Maurizio Pollini (†2024). Sein Spiel war sicherlich makellos, berührte mich aber nicht so sehr wie dasjenige anderer Künstler. Dennoch stimmte es mich traurig, als ich vor zehn Tagen von seinem Ableben erfuhr.
Schlussakkord eines Klassikweltstars, titelte die dpa.

Brendel gehörte ohne Zweifel zu jener Welt, die mir sehr lieb ist, die alte Welt der klassischen Kultur, die – quod erat demonstrandum – im Begriff ist, auszusterben. Natürlich gibt es noch Klassikkonzerte, und Leute spielen noch Klavier. Natürlich kann man noch allerorten unfassbar gute Pianisten hören. Aber das ist nicht dasselbe. Die sind nicht dasselbe.
Allein schon Brendels Lebenslauf. Geboren 1931 in Nordmähren, mit drei Umzug nach Jugoslawien auf die Adriainsel Krk. Mit sechs ersten Klavierunterricht, mit zehn Harmonielehre beim Komponisten Franjo Dugan. Dann Graz, dann Wien, dann London, wo er am 17. Juni in seinem Haus starb.
Ich gehörte, wie gesagt, nie zu seinem großen Fanclub. Aber dennoch beeindruckte er mich nachhaltig, als ich ihm 2011 begegnete. Wie es dazu kam, hab ich damals in einer Reportage für das Freiburger Stadtmagazin fudder (das zur Badischen Zeitung gehörte) festgehalten.
Für mich ist die Relektüre des Textes v.a. deshalb interessant, weil zwischen den Zeilen ganz viel Manuel von damals steckt. Ein klandestines Tagebuch, wenn man so will. Gänzlich unintentional.
Im Folgenden hab ich versucht, diesen Spuren nachzugehen – und den Text mit Fußnoten versehen. Viel Spaß bei der Lektüre! (Und bitte verzeiht die pixeligen Fotos – die Originale sind verloren gegangen.)
Der Hype und der Meister: Beim Interpretationsseminar mit Alfred Brendel (fudder / Badische Zeitung, 12. Januar 2011)
Alle schauen auf ihn: Alfred Brendel. Wir stehen in einem kleinen Backstage-Raum und es gibt Schinkengugelhupf, Mineralwasser, Rot- und Weißwein. Ein Dutzend ausgewählte Gäste – und ich.
Alle außer mir haben eine Legitimation, hier zu sein: Veranstalter, Hochschulfunktionäre und Klavierstudenten. Was mich angeht: Ich bin hier aus Versehen – aus Missverständnis – reingeraten.
Alfred Brendel ist eine lebende Legende – quasi der Grandmaster Flash des Klavierspiels.1 Wenn so einer an die Freiburger Musikhochschule kommt, muss man hin. Keine Diskussion. Auch wenn’s nur ein öffentliches Interpretationsseminar ist – sich also vier verschüchterte Klavierstudenten vor großem Publikum bespucken und beschimpfen lassen.
Konzerte gibt der Altmeister schon seit zwei Jahren keine mehr; aber alle hoffen natürlich, dass er während des Seminars möglichst viel selber spielt.
Ein Freund von mir, ein junger Pianist aus Salzburg, regt sich regelmäßig über Brendel auf. Der sei schon gut, aber eben nicht so gut, und der Kult um den 80-jährigen Klavisaurier sei übertrieben und nicht gerechtfertigt. Es gäbe da andere, ebenbürtige, bessere – aber die würden sich halt schlechter vermarkten. In einem Satz: Don’t believe the hype!
Falls es diesen Hype gibt, scheinen viele ihm aufzusitzen. Eine Großzahl bürgerlichen Publikums ist gekommen; dazwischen sitzen nicht wenige Musikhochschulstudenten.
Die Partitur von Schuberts Klaviersonate G-Dur op. 894 gehört heute Nachmittag zum Standard des redlichen Besuchers. Ich habe keine dabei und komme mir vor, als ob ich ohne Club Mate im Berliner Mauerpark herumsitze.2
Alle schauen also auf Brendel, als ob er der fleischgewordene Klaviergott sei. Und wahrscheinlich hat sich das Christkind genauso gefühlt, damals, in Bethlehem, im Stall, im Stroh, als Maria und Josef, die drei Weisen und Esel und Ochse es minuten-, nein: stundenlang anstierten.
Minus 273 Grad Celsius. Keine Teilchenbewegung. Absolute Paralyse angesichts des Wunders, das die Anwesenden da gerade erleben.
Gestern Jesus, heute Brendel – und alle hängen an seinen weichen Lippen und warten auf weise Worte des Meisters. Wegweisende vielleicht, oder einfach nur geistreiche, so wie damals, in Bethlehem, im Stall, im Stroh, als alle irgendwas vom schrumpeligen Erlöser erwarteten.
Während des Seminars redet Brendel viel. Mal streng und absolut wie Ranicki, mal mild und menschlich wie Karasek.3 Mal spielt eine Studentin ihm rhythmisch „zu lahm“, dann droht er, ihr den kleinen Finger abzuschneiden. „Gleich ohrfeigt er sie,“ empört sich eine Dame. Doch im nächsten Augenblick ist er wieder friedlich und lobt.
„Es ist seine Aura“, sagt Danlin Felix Sheng4, einer der vier Seminarteilnehmer. Er ist 21 und studiert im 5. Semester Klavier auf Bachelor. „Man wagt es einfach nicht, ihm zu widersprechen.“ Und doch ist Danlin der einzige, der während des Unterrichts seine Stimme erhebt.
Brendel sei sehr streng, penibel, kompliziert. „Aber man lernt sehr viel bei ihm. Zum Beispiel, dass Schubert nicht immer alles in die Noten geschrieben und dem Interpreten viel Gestaltungsfreiraum gelassen hat.“
Jetzt steht Danlin an einem Bistrotisch neben Brendel. Der Meister wirkt ein bisschen müde, erzählt Anekdoten, doziert, trinkt Rotwein.5 Wieder ist Danlin der einzige Student, der etwas sagt. Er spiele auch Jazzschlagzeug und im Orchester die Pauke.
Der Meister lächelt gnädig und erzählt vom Dirigenten Fritz Busch: Dieser sei, wenn jemand im Orchester ausfiel, einfach eingesprungen – egal welches Instrument. Gelächter. Zustimmung. Warten auf den nächsten Kick.
Ich denke mir: Jetzt müsstest du ihn auch mal anhauen. „Hey, Alfred, geile Sache, toll. Aber: Was sagst du eigentlich zum Aussterben der Klassik?“6 Zu polemisch, zu undifferenziert. „Hey, Alfred, was hältst du von Klassik im Club? Der berühmte Countertenor Andreas Scholl hat letztens zum Beispiel im Berghain gesungen – gleich neben den Darkrooms!“7 Zu durchsichtig, zu bemüht.8
Und auf einmal steht er vor mir, Brendel, zufällig, so wie ich auf den Empfang gelangt bin. Er schaut mir in die Augen und reicht mir die Hand. Sie ist groß, eine Pranke, und weich – eine Pfote. Sein Händedruck ist fest und bestimmt.
„Auf Wiedersehen“, sage ich und nicke. Auf Wiedersehen. Wie banal und dumm. Als ob wir uns jemals wieder sehen werden. Aber einen Augenblick lang haben wir uns gesehen – er mich und ich ihn: den Hype, den Meister, den Menschen.9
That’s all, folks. Genießt den Sommer, hört ein wenig Brendel, esst dabei Schinkengugelhupf, trinkt Mineralwasser, Rot- und/oder Weißwein und freut euch des Lebens!
Euer Manuel
Ein nicht ganz stimmiger Vergleich. Aber ich stand offenbar unter dem Eindruck des bevorstehenden Auftritts von Grandmaster Flash im damaligen Freiburger Schickimicki-Club Kagan im 18. Stock des Bahnhofsturms. Der Hip-Hop-Pionier passte dort genauso gut hin wie Mike Tyson auf ein Schachturnier, und entsprechend groß war bei uns die Aufregung, verstanden wir uns doch als Ordnungsamt des Nachtlebens. Das Kagan hatte den Ruf, Turnschuhträger an der Tür abzuweisen – was sich, wie wir fanden, mit Rap nicht vertrug. Mit Sicherheit würde der Edelclub von Sneakerheads überrannt werden. Daher konfrontierte ich den Geschäftsführer in einem Interview mit diesem Widerspruch. „Grandmaster Flash mag Turnschuhe, das Kagan nicht […]. Wie handhaben Sie das am Donnerstag?“ Ich weiß nicht mehr, was er antwortete – und die Paywall der Badischen Zeitung erlaubt es mir nicht, in meinem Text nachzuschauen. Jedenfalls fand Grandmaster Flashs Auftritt statt, und ich glaube, mein Fazit war halbwegs versöhnlich. Irgendwas in Richtung: Na ja, der Altmeister hat’s zwar immer noch drauf, aber auch er braucht mittlerweile natürlich ein wenig Geld und legt halt dort auf, wo man ihn zahlt. Und eines muss man ihm lassen: Abriss kann er.
Ein Jahr zuvor war mein Freund Willy ins sogenannte Brunnenviertel gezogen, in den Berliner Ortsteil Wedding. Schon seit einigen Jahren ging hier das Gespenst namens Gentrifizierung um, das aber noch niemanden erschreckte, sondern eher für Unterhaltung sorgte – z.B. im nahegelegenen Mauerpark. Es war die Zeit, in der Street Artists wie Alias, XOOOOX und El Bocho die guten, alten Berliner Graffitis out of date aussehen ließen. Ich selbst kaufte in der Circle Culture Gallery in Mitte ein Werk des australischen Künstlers Charlie Isoe und überführte ein „illegales“ Paste-up des Franzosen SP 38 von der Straße in mein Wohnzimmer. Im Mauerpark fand das große Abchillen statt – inklusive der zu jener Zeit unvermeidlichen Club Mate. Die berühmte Bearpit Karaoke. Das Fotografieren mit analogen Second-Hand-Kameras (2010 wurde Instagram gegründet samt seiner analogen LoFi-Optik). Das Jagen stylischer Flohmarktschnäppchen (lange bevor Kleinstädter aus aller Welt Zweite-Hand-Klamotten-Läden wie Picknweight und Humana stürmten). Die ganze Retro-Welle (siehe Simon Reynolds’ Buch Retromania von 2012).
Zehn Jahre nach dem Ende der Erstauflage des Literarischen Quartetts stand ich noch unter dem Eindruck einer rauschhaften Nachhol-Aktion. Irgendwann Mitte oder Ende der Nullerjahre hatte ich mir alle 77 Folgen des legendären Formats auf YouTube reingezogen und war noch lange – bin es vielleicht bis heute – Ranicki-Karasek-Löffler-Ultra. Drei Jahre zuvor hatte MRR öffentlichkeitswirksam den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk abgelehnt („Ich nehme diesen Preis nicht an.“). Vier Jahre später sollte(n) die Neuauflage(n) mit Weidermann, Westermann, Biller und Dorn starten. Damals, als ich meinen Brendel-Text schrieb, gab es irgendwie noch so was wie einen Kanon, auch wenn man bereits darüber diskutierte, wie sinnvoll solch eine Festlegung ist. Faust war noch fester Bestandteil gymnasialen Deutschunterrichts; Fack ju Göthe lag noch in zweieinhalbjähriger Entfernung. An unseren Versuch, mit dem rbb/ARD-Kultur-Format Studio Orange und Sophie Passmann das Literaturfernsehen zu retten, war noch gar nicht zu denken. Auch unser zweiter Literatur-Wurf Longreads mit Helene Hegemann lag noch in weiter Ferne. Aber der Damenspagat zwischen Hoch- und Subkultur war schon 2011 eine meiner Lieblingsdisziplinen.
Was macht Danlin Felix Sheng heute – knappe anderthalb Jahrzehnte nach diesem Interpretationsseminar? 2017 schloss er sein Klavierstudium mit Auszeichnung ab. Es folgte ein Bachelor in Musiktheorie. Mehrere erste Preise bei Jugend musiziert und internationalen Wettbewerben. Recitals, Festivals, Klavierkonzerte sowie Kammermusik in Deutschland und Europa. Engagements für die Bamberger Symphoniker, das hr-Sinfonieorchester, das Tonhalle Orchester Zürich. Klavierlehrer. Und – dazu komme ich noch im Text – Pauker und Schlagzeuger in diversen Orchestern. Summa summarum: Er scheint wohlauf.
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie eine hochrangige Freiburger Kulturdame ihn anschmachtete wie Teenies Harry Styles. Sie lobte einen seiner Lyrikbände – Kleine Teufel? Ein Finger zuviel? – zitierte daraus, hielt ihn ihm hin, auf dass er ihn signieren könne. Warum fand die Frau keinen Eingang in den Text? War sie zu leicht zu identifizieren? Hätte es Ärger gegeben? Krach? Ich weiß es nicht mehr.
Das war damals mein großes Thema – und ich schrieb dagegen an, indem ich Klassik so rezensierte, dass es auch Nicht-Klassik-Hörer verstanden. Ich weiß nicht, ob es etwas gebracht hat. Es gibt zwar mehr Vermittlungsformate denn je, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Was das Elternhaus, die Schule – die Gesellschaft – unterlässt (junge Menschen an klassische Musik heranzuführen), können Konzerthäuser und Co. kaum auffangen. Es gibt zwar immer wieder auch Studien, die Hoffnung machen. Aber ob die blühenden Orchesterlandschaften die nächsten Jahrzehnte überleben werden … Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Stattdessen erfreue ich mich an jedem Klassikkonzert, das ich noch zu halbwegs plausiblen Ticketpreisen besuchen kann. Und „was vorbei is’, is’ vorbei, Baby Blue“ (Falco).
Die Deutsche Grammophon war das erste Label, das Klassik in die Clubs brachte. Seine Veranstaltungsreihe Yellow Lounge gastierte in Partylocations wie dem Säälchen oder sogar im Berghain. Als Liebhaber beider Welten schien dieser Ansatz wie gemacht für mich. Auch in Freiburg, wo ich damals lebte, sprang man auf den Zug auf. Mit der Reihe Linie Zwei versuchte das SWR Symphonieorchester ebenfalls, eher ungewöhnliches Repertoire auf eher ungewöhnliche Weise an eher ungewöhnlichen Orten aufzuführen, um damit ein anderes, jüngeres Publikum zu erreichen. Leider blieb es meiner Beobachtung nach beim „eher“, und so scheiterte das Unterfangen, und am Ende kamen doch wieder dieselben wie immer. (Die Reihe gibt es trotzdem noch – am 3. Juli findet die nächste Ausgabe [wie eh und je] im E-Werk statt.)
Apropos Berghain: Bei meinen Berlin-Besuchen Ende der Nuller-, Anfang der Zehnerjahre, die immer häufiger wurden, nahm Willy mich regelmäßig in den sagenumwobenen Techno-Club mit. Es war die Zeit um Helene Hegemanns Axolotl Roadkill (2010), jenen Roman, der eine wilde Debatte im Feuilleton losgetreten hatte. Für ihre Berghain-Szenen hatte sich die damals 17-Jährige nämlich beim autofiktionalen Roman Strobo (2009) des Bloggers Airen bedient.
Fun Fact #1: Strobo hatte ich mir antiquarisch bestellt – und er war nie angekommen. Bzw. bei einem Nachbarn namens „Herr Schmidt“, der sich als Phantom erwies. Ich rannte wochenlang durchs Treppenhaus, klingelte an jeder Tür. Kein Schmidt. Und ergo auch kein Buch. Ich gab auf und beließ es dabei. Soll heißen: Ich kaufte es mir kein zweites Mal.
(Was gleichzeitig dazu führte, dass ich mir Axolotl Roadkill nicht kaufte – denn ohne das eine gelesen zu haben, machte für mich das andere keinen Sinn.)
Fun Fact #2: Helene traf ich ein paar Jahre später mal auf einer Dachterassenparty in Berlin. Soll heißen: Sie war auf derselben Party wie ich anwesend. Ein bisschen wie ein Gespenst. „Da hinten steht Helene Hegemann“, bedeutete mir einer der Gäste. Und genauso plötzlich, wie sie aufgetaucht war, war sie an jenem Abend auch wieder verschwunden. 2017 kam ihr Film raus (Axolotl Overkill), ich interviewte sie, und sie nannte mich „Hübschi“ (hier nachzulesen). 2022 war sie Gast in unserem Literaturformat Studio Orange (mit Bolaños Klopper 2666). 2024 starteten wir mit ihr und Lena Brasch Longreads.
In meinem Erasmus-Jahr in Pisa 2004/05 verliebte ich mich in einen Film, der damals schon nicht mehr ganz so neu war: Lammbock (2001) mit Moritz Bleibtreu. Ein Kult-Film – und v.a. ein Stoner-, also: Kiffer-Film. Ich habe ihn bestimmt 30 Mal gesehen – so oft wie keinen anderen. Ich konnte ihn (natürlich) nicht nur mitreden, sondern verwendete Lammbock-Zitate in jeder erdenklichen Situation. Dies hielt offenbar bis ins Jahr meiner Brendel-Reportage an – denn nicht nur überraschte mich Willy zu meinem 30. Geburtstag im September mit einem großen Lammbock-Quiz (bei dem ich leider ziemlich versagte). Nein, auch schaffte es ein Zitat aus einer meiner Lieblings-Szenen des Films in meine Brendel-Reportage. Darin erklärt ein Polizei-Ausbilder den jungen Kollegen, woran sie Kiffer erkennen und wie diese sich auszudrücken pflegen. „,Guter Shit, Alter!‘ Völliger Quatsch. So redet kein Mensch mehr, nur noch Sozialpädagogen und Lehrer. ,Das Zeug kickt besser als Mehmet Scholl!‘ Zu bemüht, durchsichtig. Nein, dieses Dope, meine lieben Freunde, ist kein gewöhnliches Dope. Dieses Dope ist die Deluxe-Version. Dieses Dope ist die Jakobs-Krönung des THC.“
Übrigens #1: Lammbock ist schlecht gealtert. Die 90er sind vorbei – Kiffen ist längst Kinderkram. Andere Drogen, die im Film nur eine marginale Rolle spielen, sind ins Zentrum gerückt. In The Wire wird Crack und Heroin vertickt, in Breaking Bad geht’s um Crystal Meth, in Narcos um Kokain. In Berlin Calling u.a. um Extasy, im Indie-Film Yung um GHB. Kiffende (weiße, cis-sexuelle) Slacker wie Stefan und Kai aus Lammbock wirken in dieser harten, abgestumpften, ja, bisweilen kaputten Gesellschaft so altbacken wie beige Anglerwesten auf karierten Kurzarmhemden.
Übrigens #2: Das Lammbock-Sequel Lommbock (2017; Trailer) habe ich mir noch nicht angeschaut. Willy und ich warten noch auf den richtigen Moment dafür.
Wahrscheinlich führte dieser Text dazu, dass mir ein Freund, J., ein Jahr später Brendels A bis Z eines Pianisten: Ein Lesebuch für Klavierliebende zum Geburtstag schenkte. Ich weiß nicht mehr, wie ich reagierte. (Und traue mich nicht, nachzufragen.)